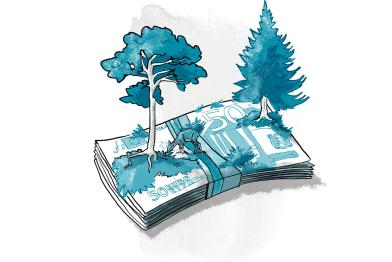Klimaschutz jetzt
Wir müssen die Klimakrise aufhalten - und zwar schnell!
Die Klimakrise bedroht die Lebensgrundlagen der Menschheit. Doch das Problem ist menschengemacht, und noch können wir das Klima schützen. Wenn wir radikal Treibhausgase senken, gibt es Hoffnung.
Die vom Menschen gemachte Erderhitzung ist die größte Bedrohung unserer Zeit. Wissenschaftler:innen warnen, dass die globale Durchschnittstemperatur bis 2100 um bis zu sechs Grad steigen wird, wenn wir den Ausstoß an Treibhausgasen nicht gewaltig senken. Das Wettersystem, wie wir es heute kennen, würde kollabieren. Das müssen wir verhindern!
Auch das Wetter wird dann verrücktspielen: Extremwetter wie Starkregen, verheerende Stürme oder Überflutungen werden zunehmen. Auch Hitzewellen, Dürrezeiten und Waldbrände. Schon jetzt toppt jedes Jahr das Vorangegangenen an Katastrophen. Und das ist erst ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da auf uns zu kommt. Schmelzen die Polkappen und Gletscher dieser Welt, droht im schlimmsten Fall ein Meeresspiegelanstieg um bis zu 66 Meter. Küstenmetropolen und Inselstaaten auf der ganzen Welt könnten im Meer versinken.
Klimaschutz einfach erklärt
Warum Klimaschutz Menschenschutz ist
Alle reden vom Klimaschutz, aber was ist das eigentlich? Das Klima droht ins Chaos zu stürzen, weil der Mensch die Erde zu sehr aufheizt. Schuld daran sind sogenannte Treibhausgase, die wir Menschen zum Beispiel beim Verbrennen von Kohle, Öl und Gas, also beim Heizen, Stromgewinnen oder Autofahren ausstoßen. Diese Gase führen dazu, dass sich die Erde zu stark erwärmt. Das löst die Klimakrise aus, mit heftigen Stürmen und Überschwemmungen, Meeresspiegelanstieg und Gletscherschmelze.
Klimaschutz meint also, diesen Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und irgendwann ganz zu stoppen. Das ist wichtig, denn die Klimakrise bedroht die gesamte Menschheit! Aber wir Menschen können die Klimakrise verhindern und das Klima schützen! Wir müssen nur weniger Treibhausgase ausstoßen. Das geht, indem wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, den Strom stattdessen aus Wind- und Sonnenkraft gewinnen, weniger Fleisch essen, unsere Nahrung umweltfreundlicher erzeugen und Energie sparen. Das alles ist gelebter Klimaschutz. Damit auch unsere Kinder noch eine gute Welt zum Leben haben.
Mehr einfache Erklärungen in unserem Umwelt-Glossar.
Verdorrte Landschaften, überflutete Großstädte, Regionen, die unbewohnbar werden – die Prognosen sind apokalyptisch. Vom Menschen erzeugte Treibhausgase heizen die Erde auf. Wenn es uns nicht gelingt, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen, wird das Klimasystem, wie wir es heute kennen, völlig durcheinandergeraten. Jahrtausende alte Klimamuster würden sich ändern, Regenperioden verschieben oder ausbleiben – mit katastrophalen Auswirkungen auf die Landwirtschaft und Welternährung. So prognostizieren es die internationalen Klimawissenschaftler:innen in ihrem 6. Sachstandsbericht des IPCC.
2023/2024 lag erstmals die globale Durchschnittstemperatur 12 Monate über der 1,5 Grad-Marke. Da das Wetter aber ein langfristiges und sehr komplexes System ist, muss das nicht heißen, dass das Pariser Klimaziel schon obsolet ist. Tatsächlich rentiert es sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Noch bleiben wenige Jahre Zeit, um die ganz große Katastrophe zu verhindern. Nicht viel, für die gewaltige Aufgabe, die vor der Menschheit liegt. Doch noch kann sie die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise abwenden, wenn sie jetzt den Ausstoß an Treibhausgasen radikal senkt. „Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt, denn das tut es“, sagte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in ihrer Rede zum Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos. Und sie hat Recht. Wir müssen jetzt ganz schnell aktiv werden. Denn die Zeit, zu handeln, die ist extrem knapp.
Ursachen des Klimawandels
Ursache für den Klimawandel sind Treibhausgase, vor allem Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas. Aber auch Klimagase aus der Landwirtschaft oder das Abholzen alter Wälder kurbelt den Klimawandel an.
Mengenmäßig überwiegt das Klimagas Kohlendioxid (CO2). Es entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Energieträger wie Kohle, Öl und Gas verbrannt werden, also bei der Stromerzeugung in Kohle- oder Gaskraftwerken, beim Heizen mit Öl oder Gas oder beim Autofahren. Aktuelle Zahlen zum weltweiten CO2-Ausstoß finden Sie auf Climate Trace.
So kompliziert das Problem ist, so vielschichtig muss auch die Lösung sein. Über alle Sektoren und über alle Ländergrenzen hinweg müssen die Treibhausgase radikal reduziert werden, um die Klimakrise auszubremsen. Weltweit müssen die Netto-Treibhausgasemissionen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auf null sinken, das heißt, dass nicht mehr Klimagase ausgestoßen werden dürfen, als die Treibhausgas-Senken wieder aufnehmen können.
Wissenschaftler:innen warnen, dass die Erderhitzung auf unter 1,5 Grad begrenzt werden muss, weil die Klimakrise sonst unbeherrschbar wird. Dekliniert man dieses Ziel auf Treibhausgasmengen herunter, die jedes Land der Erde noch verbrauchen kann, ergibt sich ein klarer „Reduktionspfad“. Dabei sind die Industrienationen, die mit ihrer Wirtschaftsleistung und ihrem Lebensstil die Klimakrise hauptsächlich erzeugt haben, besonders in der Pflicht, ihre Treibhausgase schnell zu senken. Noch bevor Schwellen- und Entwicklungsländer ihren Beitrag zum 1,5 Grad-Ziel leisten müssen.
Die nötigen Maßnahmen sind weltweit ähnlich: Kohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden. Es braucht eine Energiewende weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien, ein völliges Umschwenken in der Mobilität, eine andere Landwirtschaft und einen vehement reduzierten Fleischkonsum. Große Aufgaben, sicherlich, aber machbare: Die technischen Lösungen, die wir brauchen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, haben wir alle. Wir müssen sie nur anwenden.
Klimaschutz in Deutschland
Deutschland zum Beispiel muss sogar schon vor 2040 klimaneutral sein. Das heißt, anders als mit dem Kohleausstieg 2019 beschlossen, müssen spätestens 2030 das letzte Braunkohlekraftwerk und auch das letzte Steinkohlekraftwerk vom Netz gehen.
Für den Ausstieg aus fossilem Gas müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Bis 2035 müssen auch die Gaskraftwerke abgeschaltet oder auf grünen Wasserstoff umgerüstet werden; Wärmesektor und Verkehr müssen vor 2040 klimaneutral sein. Dann muss auch der durchschnittliche Fleischkonsum halbiert und die Landwirtschaft ökologisiert sein.
CO2 kann natürlich nicht nur in die Atmosphäre entweichen, es kann auch über Photosynthese aus der Atmosphäre wieder herausgeholt und in Biomasse gespeichert werden. Bäume, Pflanzen und das Plankton der Meere sind also unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Je länger diese Biomasse nicht wieder zersetzt oder verbrannt wird, umso länger wird das Klimagas aus der Atmosphäre entzogen. Wälder sind gigantische solcher Klimagas-Senken, je naturnaher sie bewirtschaftet werden, je älter die darin wachsenden Bäume sind, umso mehr.
Auch humusreiche Böden und Moore sind gigantische Kohlenstoffspeicher. Trocknen Moore allerdings aus – beispielsweise, weil Menschen sie entwässern, um Ackerland zu gewinnen – entweichen die im Moor gespeicherten Klimagase wieder in die Atmosphäre. Eine weitere wichtige CO2-Senke sind die Weltmeere. Doch auch hier muss der Mensch aufpassen, das Ökosystem zu schützen und lebendig zu halten. Nicht nur zum Schutz der darin lebenden Arten. Sondern eben auch, um uns Menschen ihre Funktion als klimaschützende Kohlenstoffsenke zu erhalten.
Klimaschutz braucht auch China, USA und Indien
Die Klimakrise ist ein so komplexes Problem, dass einem schwindelig werden kann. Für sinnvollen Klimaschutz braucht es ein konzertiertes Vorgehen fast aller Länder weltweit. Und doch auch wieder jeden einzelnen Menschen, der zu einer Veränderung seiner Lebensumstände bereit sein muss. Zwar müssen Industrienationen vorangehen und beim Klimaschutz einen größeren Beitrag zur Reduzierung leisten als Schwellen- oder Entwicklungsländer. Gerade die USA und Europa sind da besonders in der Pflicht. Und das nicht nur wegen ihrer historischen Schuld an der Klimakrise. Immer noch tragen diese beiden Wirtschaftsräume massiv zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Die USA sind Weltranglistenzweite. Und Europa liegt bei deutlich weniger Einwohnern knapp hinter Indien auf Platz vier.
Aber die anderen Nationen braucht es natürlich auch. Gerade bevölkerungsreiche Schwellenländer wie China und Indien müssen beim Klimaschutz mit im Boot sein. Zwar stößt der Durchschnittsmensch in China pro Kopf immer noch deutlich weniger CO2 aus wie eine:r in den USA (2023 waren das in China 8,4 Tonnen CO2 pro Kopf und in den USA 14,5), aber absolut betrachtet verursacht China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohner:innen trotzdem die meisten Treibhausgase weltweit. 2023 waren das 13 Gigatonnen CO2, und damit 34 Prozent des weltweiten CO2-ausstoßes. Platz zwei belegte 2023 die USA mit 4,7 Gigatonnen Co2 (entspricht 12 Prozent des weltweiten Ausstoßes), auf Platz drei lag Indien mit 3 Gigatonnen (7,6 Prozent). Obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch in Indien zur gleichen Zeit nur ca. 5 Tonnen CO2 betrug. Europa stieß 2023 2,5 Gigatonnen (6,5 Prozent) CO2 aus und lag damit auf Platz vier. (Quelle: EDGAR - The Emission Database for Global Athmospheric Research)
Indien und China haben angekündigt, ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten zu wollen. In den USA ist mit Donald trump leider gerade wieder ein Klimaskeptiker an der Macht. Vorher bemühten sich auch die USA um Klimaschutz. Doch wie in Deutschland auch werden erst die konkreten Klimaschutzgesetze und im Endeffekt das Handeln in den nächsten Jahren zeigen, ob die Länder wirklich bereit sind, ihren Worten auch die notwendigen Taten folgen zu lassen.
Wir alle können bei uns zu Hause anfangen – jedes Land, und jeder Mensch im Einzelnen. In der Hoffnung, dass auch der nächste Mensch, das nächste Land das Seine tut, um die Klimakrise aufzuhalten.
Was nicht hilft - Atomkraft und CCS sind keine Lösungen gegen die Klimakrise
Um die gewaltige Aufgabe zu schaffen, die Erderhitzung aufzuhalten, wird es auch viele neue technische Lösungen geben und geben müssen. Innovative Ansätze für Elektro-Roller und klimafreundlichen Flugverkehr gehören dazu. Neue Speichermöglichkeiten für Strom und Energie auch, oder smarte Kopplungssysteme in der Energiegewinnung. Was aber im Strauß der Lösungen keinen Platz haben sollte, ist Atomkraft. Denn diese Energieform ist viel zu gefährlich. Der eher marginale Beitrag, den Atomkraft zur weltweiten Energieversorgung leisten kann, rechtfertigt in keinster Weise die Risiken eines Super-GAUs oder die Probleme mit dem hunderttausende Jahre strahlenden Atommüll.
Auch CCS ist keine Lösung. Die Technik “Carbon Capture and Storage”, zu deutsch CO2-Abscheidung und -Speicherung, brachte die Kohleindustrie in den letzten 20 Jahren immer wieder ins Feld, um ihre Kohlekraftwerke über die Energiewende zu retten. Doch die Idee, das CO2 aus der Abgasluft der Kohlekraftwerke herausfiltern, zu verpressen und unter der Erde oder am Meeresboden zu lagern, birgt gewaltige Gefahren: Lagerten gigantische Mengen CO2 im Untergrund, genügten winzigste Leckagen, um jegliche Klimaschutzbemühungen in Zukunft zu torpedieren.
Nein, wir dürfen die Verantwortung für den notwendigen – den die Not der Klimakrise abwendenden – Klimaschutz nicht weiter in die Zukunft schieben. Wir müssen jetzt ehrlich und radikal Kohlekraftwerke abschalten, die Energiewende hinbekommen, den Verkehr dekarbonisieren, den Fleischverbrauch reduzieren und die Treibhausgase senken. Weltweit – aber vor allem und zuerst einmal bei uns in Deutschland. Das hat sogar das deutsche Verfassungsgericht 2021 in seinem historischen Urteil zur der Klimaklage gerichtlich festgehalten: Die zukünftigen Generationen haben ein Recht auf eine lebenswerte Welt. Deshalb muss die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz daraufhin nachbessern, dass Deutschland seinen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel leistet.
Die Lage ist dramatisch und die Zeit drängt, das zeigt die neuerliche Jahrhundertflut im Juni 2024 in Bayern wieder einmal deutlich. Aber wenn wir jetzt unsere Angst überwinden, mit Mut und Hoffnung nach vorne schauen und die Aufgaben anpacken, können wir es schaffen. Immerhin haben wir noch einige Jahre Zeit, die Klimakrise aufzuhalten. Wir sind die letzte Generation, die das kann.
Häufig gestellte Fragen zum Klimaschutz
Was ist das 1,5 Grad-Ziel?
Sollten die Temperaturen um mehr als 1,5 Grad Celsius ansteigen, befürchten Experten dramatische Schäden für die Ökosysteme und unumkehrbare Beeinträchtigungen des Klimasystems. Nur wenn wir es schaffen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen können wir mit den Folgen der Klimakrise noch umgehen.
Ist die Klimakrise noch aufzuhalten?
Nein, aufhalten können wir die Klimakrise nicht mehr. Doch die schlimmsten Folgen des Klimawandels können wir noch verhindern - wenn wir jetzt die Notbremse ziehen. Die weltweiten Treibhausgas-Emissionen müssen bis 2050 nahezu zum Erliegen kommen, dann kommen wir mit einem blauen Auge davon.
Was bringen internationale Klimaverhandlungen?
Erfolgreiche internationale Klimaverhandlungen sind unverzichtbar auf dem Weg zur Rettung unseres Planeten, denn ohne globale Zusammenarbeit und völkerrechtlich bindende Verträge wie das Kyoto-Protokoll kann die Klimakrise nicht aufgehalten werden.
Wer ist der Hauptverursacher des Klimawandels?
Grund für die Erwärmung ist letztlich unsere Lebensweise in den Industriegesellschaften. Die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas, Autofahren und Fliegen, die Abholzung von Wäldern und nicht zuletzt der steigende Fleischkonsum verursachen rasant zunehmende Treibhausgasemissionen.
Warum ist gerade Kohle so klimaschädlich?
Stein- und Braunkohlekraftwerke sind die klimaschädlichsten Kraftwerke überhaupt. Kohle enthält sehr viel Kohlenstoff, der bei der Verbrennung als CO2 freigesetzt wird und den Klimawandel anheizt. So stoßen Braunkohlekraftwerke zwischen 900 und 1200g CO2/kwh aus – rund drei bis viermal so viel wie ein modernes Gaskraftwerk. Kohlekraftwerke haben zudem einen sehr schlechten Wirkungsgrad (zwischen 30 und 46 Prozent).