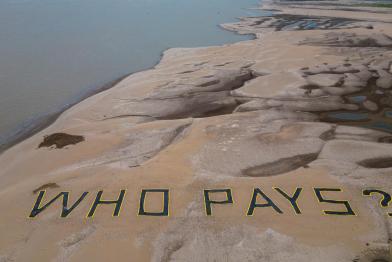Meereserwärmung – die Hitzewelle unter Wasser
- Hintergrund
Die Ozeane haben bislang etwa 80 Prozent der Wärme aufgenommen, die wir dem Klimasystem zugeführt haben. Die Erwärmung reicht bis in eine Tiefe von 3.000 Metern. Das bringt die Meere aus dem Takt.
“Ist doch nicht schlimm, wenn das Meer wärmer wird, schwimmen in Badewannentemperatur ist doch herrlich.” Aussagen wie diese sind leider ein weit verbreiteter Mythos. Das Meer und das Klima sind durch eine unsichtbare, aber kraftvolle Verbindung miteinander verknüpft. Die Erwärmung der Meere ist nicht nur eine Folge der Klimakrise, sie verstärkt auch ihre Auswirkungen.
Jahrelange Rekordtemperaturen im Meer
Unsere Ozeane sind wunderschön und überlebenswichtig – für uns alle! Als größter Lebensraum der Erde beherbergen sie eine riesige Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Sie produzieren mehr als die Hälfte des Sauerstoffs zum Atmen, liefern Nahrung für Millionen von Menschen, regulieren das Klima und drosseln die menschgemachte Erderhitzung. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als würden die Meere unberührt von den Veränderungen auf unserem Planeten bleiben. Doch die Wahrheit ist eine erschreckend andere. Marine Hitzewellen haben verheerende Folgen für unser gesamtes Ökosystem und letztendlich auch für die Menschheit. Seit März 2023 sind die Meere jeden Monat durchgehend wärmer als je zuvor, das zeigen wissenschaftliche Quellen der amerikanischen Ozean-Behörde NOAA und des Climate Change Institute der University of Maine:

© Denis Sinyakov / Greenpeace
Ein Walross liegt auf einer Eisscholle vor dem Sjettebreen-Gletscher in Spitzbergen, Norwegen.
Wie beeinflussen sich Meer und Klima gegenseitig?
Die Meere der Welt bedecken etwa 71% der Erdoberfläche und spielen eine entscheidende Rolle im Klimasystem unseres Planeten. Sie wirken wie ein riesiger Wärmespeicher und absorbieren einen Großteil der Sonnenenergie. Diese Energie wird an der Oberfläche gespeichert, aber auch in tiefere Wasserschichten transportiert, was zur Erwärmung der Ozeane beiträgt. Gleichzeitig gibt das Meer Wärme an die Atmosphäre ab und beeinflusst so das Wetter und Klima weltweit.
Auf der anderen Seite wirkt sich die Erderhitzung auf das Meer aus. Die höheren Temperaturen erwärmen die Weltmeere, was wiederum eine Reihe von Folgen nach sich zieht.
Warum steigt die Meerestemperatur?
Die Hauptursache für die Erwärmung der Meere ist die menschengemachte Klimakrise, verursacht durch die Emission von Treibhausgasen wie CO2. Diese Gase fangen Wärme in der Atmosphäre ein und führen zu einer globalen Erwärmung. Das Meer absorbiert einen Teil dieser Wärme, was zur Erwärmung der Ozeane führt. Durch die Erhitzung schmelzen Polkappen und Gletscher - der Meeresspiegel steigt. Das wiederum bedroht Küstenregionen und Inselstaaten.
Die Folgen der Ozeanerhitzung auf einen Blick:
- Verlust der Artenvielfalt: Die Ozeane beherbergen eine unglaubliche Vielfalt an Lebensformen, von winzigen Plankton-Organismen bis hin zu riesigen Walen. Doch die steigenden Temperaturen setzen viele dieser Arten unter enormen Druck. Korallenriffe, die als die "Regenwälder der Meere" bekannt sind, sind besonders gefährdet. Die Korallenbleiche, ausgelöst durch die Erwärmung der Meere, zerstört diese sensiblen Ökosysteme und führt zum Massensterben von Fischen, Meeresschildkröten und anderen Lebewesen, die von den Riffen abhängig sind. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass sogar die Sauerstoff-produzierenden Meeresbakterien (Prochlorococcus) durch die Wasserwärmung stark beeinträchtigt werden. Etwa die Hälfte dieser lebenswichtigen Sauerstofflieferanten könnte durch die Erwärmung verschwinden. Dies hätte unabsehbare Folgen für das Leben im Meer.
- Meeresspiegelanstieg: Eine der offensichtlichsten Folgen der Erwärmung der Meere. Wenn die polaren Eiskappen und Gletscher schmelzen, fließt das Wasser in die Ozeane und der Meeresspiegel steigt. Das hat schwerwiegende Auswirkungen auf Küstengemeinschaften weltweit, die von Sturmfluten, Überflutungen und Erosion bedroht sind. Ganze Inseln könnten im Laufe der Zeit verschwinden und Millionen von Menschen könnten gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen.
- Veränderungen im Wetter: Die Erwärmung der Meere beeinflusst das Wetter auf globaler Ebene. Durch die Erwärmung der Oberflächengewässer können sich tropische Stürme und Hurrikane schneller bilden und intensivieren. Diese Stürme verursachen nicht nur direkte Schäden durch Wind und Regen, sondern können auch zu langfristigen ökologischen Veränderungen führen, indem sie ganze Ökosysteme zerstören.
- Versauerung der Ozeane: Der höhere CO2-Gehalt in der Luft führt neben der Erwärmung der Meere auch dazu, dass die Meere versauern. Wenn die Ozeane mehr Kohlendioxid aufnehmen, erhöht sich der Säuregehalt des Wassers. Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf die marinen Lebensgemeinschaften. Die Kalkhülle von Plankton-Organismen kann sich in dem zu sauren Wasser auflösen. Ohne diese schützende Hülle können sie nicht leben.
- Verlust von Lebensgrundlagen: Letztendlich führt die Erwärmung der Meere zu einem Verlust von Lebensgrundlagen für Millionen von Menschen, die direkt oder indirekt von den Ozeanen abhängig sind. Wenn Ökosysteme geschädigt werden, leiden auch die Menschen, die von ihnen abhängig sind.
Welche Meerestiere sind von der Ozeanerhitzung betroffen?
- Fische: Durch den Temperaturanstieg verändern sich ihre Verbreitungsmuster, das kann zum Beispiel ihre Wanderungen und auch das Verhalten ihrer Nahrungsquellen verändern. Einige Arten könnten gezwungen sein, sich in kühlere Gewässer zu bewegen, was zu Konflikten mit anderen Arten führen könnte. Andere könnten Schwierigkeiten haben, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen, was zu einem Rückgang der Populationen führen könnte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Hering. Durch die steigenden Temperaturen schlüpfen die Heringslarven zu früh, die Meeresumwelt hält für sie dann jedoch noch nicht genügend Nahrung bereit. Infolge dessen verhungern viele Jungtiere.
- Meeresvögel: Meeresvögel und Säugetiere, die von Fischen und anderen Meereslebewesen abhängig sind, leiden ebenfalls. Die sich verändernden Fischbestände beeinträchtigen die Nahrungsversorgung der Tiere.
- Plankton: Planktonische Organismen wie z.B. Phytoplankton bilden die Grundlage vieler mariner Nahrungsnetze im Meer. Höhere Temperaturen und indirekte Veränderungen in der Nährstoffverfügbarkeit des Wassers beeinträchtigen das Plankton.
- Meeresschildkröten und andere Reptilien: Die Temperatur des Sandes, in dem Meeresschildkröten ihre Eier ablegen, beeinflusst das Geschlecht der Nachkommen. Bei einer zunehmenden Erwärmung der Ozeane besteht die Gefahr, dass mehr weibliche Schildkröten schlüpfen, was zu einem Ungleichgewicht der Geschlechter und zu einer Verringerung der Fortpflanzungsraten führt.
- Eisbären: Mit dem Rückgang des arktischen Meereises sehen sich Eisbären mit einem dramatischen Verlust ihres Jagdgebietes konfrontiert. Sie müssen längere Strecken schwimmen, um Futter zu finden und aus ihrer Jagd wird ein schwieriges Hindernisrennen. Einige Eisbären gehen dazu über, in Siedlungsgebieten nach Nahrung zu suchen und kommen dabei in Konflikt mit Menschen. Bei den Eisbären Verändert sich außerdem ihr Fortpflanzungsverhalten und durch den Stress der sich verändernden Umwelt sind sie anfälliger für Krankheiten. Das kann die langfristige Überlebensfähigkeit der Eisbären gefährden. Die Erwärmung der Ozeane ist eine existenzielle Bedrohung für die majestätischen Arktisbewohner.