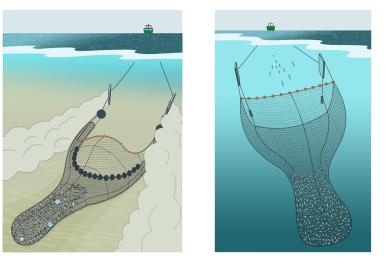Norwegen bleibt bei seiner hohen Walfangquote
- Hintergrund
Archiviert | Inhalt wird nicht mehr aktualisiert
Seit Norwegen seinen Walfang im Jahr 1993 wieder aufgenommen hat, wurden die festgesetzten Fangquoten fast nie ausgeschöpft. Dass die norwegische Regierung trotzdem so beharrlich am Walfang festhält, ist eine rein symbolische Handlung und politische Taktik. Sie vermittelt der walfangtreibenden Küstenbevölkerung den Anschein, dass ihre Anliegen auf höchstem Niveau unterstützt und diskutiert werden.
Tatsächlich dient das Festhalten am Walfang als Deckmantel, um die eigentlichen und sehr viel schwierigeren Meeresthemen zu verschleiern. So können dringende Themen aus dem Fokus der Diskussion und Öffentlichkeit genommen werden: die Reduzierung von Fangkapazitäten in der Tiefseefischerei, effektive Kontrollen der Piratenfischerei, das Beachten und Befolgen von wissenschaftlichen Empfehlungen für Fischfangquoten und die Notwendigkeit, Meeresschutzgebiete einzurichten.
Der Walfang beschäftigt in Norwegen gerade noch rund 100 Personen pro Jahr und ist wirklich nur ein marginales finanzielles Geschäft. Zum Vergleich: Seit Norwegen 1993 den Walfang wieder aufgenommen hat, haben jedes Jahr durchschnittlich 800 Fischer: innen ihren Arbeitsplatz in der Fischerei verloren.
Die letzten Jahre haben bewiesen, dass es keinen Markt mehr für Walfleisch gibt. Norwegen sollte sich ein Beispiel an Island nehmen. Es sollte diesen politisch motivierten Walfang endlich stoppen und mehr Einsatz und Engagement im Umgang mit den wirklichen Herausforderungen in der Meeres- und Fischereipolitik zeigen.