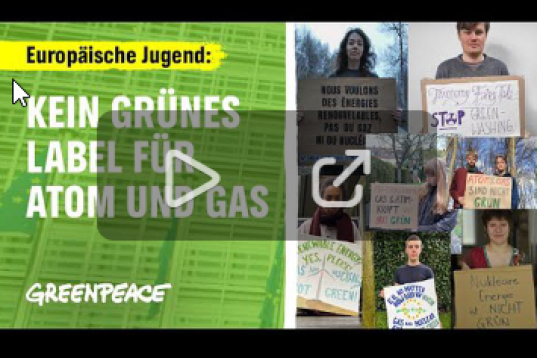Die Vielfalt der Wälder bewahren
Als einzigartiger Lebensraum und als Verbündete gegen die Klimakrise brauchen sie dringend unseren Schutz.
Weltweit engagiert sich Greenpeace für den Schutz der Wälder und zieht Verantwortliche zur Rechenschaft. Helfen Sie uns dabei - mit Ihrer persönlichen Wald-Patenschaft!
Unsere Erfolge - eine Auswahl
Greenpeace – im Einsatz für Umweltschutz und Frieden
Greenpeace engagiert sich international für Klimaschutz, Artenvielfalt und den Frieden. Dabei unterstützen uns mehr als drei Millionen Menschen weltweit, davon mehr als 620.000 Fördermitglieder in Deutschland. In mehr als 50 Ländern setzen sich regionale Greenpeace-Büros mit gewaltfreien Aktionen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von Mensch und Natur und Gerechtigkeit für alle Lebewesen ein. Dabei lebt Greenpeace vom Mitmachen - mehr darüber, wie einfach das geht, steht hier.